Das Symposium Mobile Textkulturen beleuchtete den Einfluss von Mobilität auf die Kulturtechnik des Schreibens. Im folgenden Interview-Essay beschäftigt sich der Autor Hartmut Abendschein mit Fragen handschriftlichen Schreibens unter den Bedingungen des “digital shift”: Wie verändert sich Schreiben (und Lesen), wenn eine Kultur immer stärker auf Handschriftlichkeit verzichtet? Wie verändert sich Subjektivität unter solchen Voraussetzungen? Welche technischen Errungenschaften können Handschriftlichkeit unterstützen bzw. supplementieren und was kann daraus folgen? Welche Konsequenzen hat das für verschiedene Literaturbegriffe? Das Konzept dieses Handschriften-Experiments wurde in einem literarischen Weblog entwickelt. Die Fragen stellten Stefan Ruess, Sabine Jansen und BH Franzen. Hinweise auf Dokumente und Materialien finden sich hier.
Was treibt Dich dazu, im Zeitalter schwindender Handschriftlichkeit den Fokus auf eine aussterbende Kulturtechnik zu richten? Welche Erkenntnisse erhoffst Du Dir? Oder glaubst Du nicht an eine Erkenntnis, sondern nur an den Reiz des Archivierens?
„Verzeih mir meine unausstehliche Schrift und meinen Mißmuth darüber. Du weißt, wie sehr ich mich darüber ärgere, und wie meine Gedanken dabei aufhören.“ Und: „Ja, die Barbarei meiner Handschrift, die niemand mehr lesen kann, ich auch nicht! (Weshalb lasse ich meine Gedanken drucken? Damit die für mich lesbar werden. Verzeihung, auch dafür!)“ Und: „Das Ms erweist sich seltsamer Weise als ‚unedierbar‘. Das kommt von dem Princip des ‚mihi ipso scribo‘“, heisst es in Briefen Friedrich Nietzsches an Carl von Gersdorff, Franz Overbeck und Paul Rée.
Entschuldigend, aber auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein erläuternd, bemerkt Nietzsche also die Unlesbarkeit seiner Handschrift, gesteht ihr aber auch ein Maß an Exklusivität zu, die wohl einem Typoskript, einer edierten Gedrucktheit, einem lesbaren Text abhanden käme.
“Ich schreibe mir selbst“ enthält in gewissem Sinne eine zweifache 1. Person Singular. Eine Doppelung und Singularität, so kann man sich vorstellen, die auf die eine oder andere Weise in bestimmten Textprozessen verloren geht, bestimmte Sichtweisen oder Lektüren eines Textes vielleicht nicht zwangsläufig entstellen, aber doch homogenisieren, um nicht zu sagen: Aspekte ausblenden, um einer rascheren Verarbeitbarkeit willen.
Während das 18. und 19. Jahrhundert durchaus noch als Zeiten der Brief- und damit Handschriftenkultur bezeichnet werden können, so treten etwas später, bedingt durch technische Neuerungen und resultierende Mentalitätswechsel und Zäsuren Verschiebungen ein, die generell das Schreiben verändern, handschriftliches Schreiben mehr und mehr privatisieren, sodass heute vielleicht festgestellt werden kann, dass diese Kulturtechnik schon im Aussterben begriffen ist, eine bestimmte mediale Zwischenstufe eines Erkenntnisvorgangs beim Verfassen von Texten also systematisch und breitenwirksam übersprungen wird.
“Am Nullpunkt des Texts“, so der Titel dieses kleinen Versuchs, mag vielleicht ein wenig an einen Text von Roland Barthes erinnern. Auch das kommt nicht von ungefähr, beschäftigte dieser sich doch auch prominenterweise mit dem Schreiben und machte in den 1960ern mit anderen Theoretikern einen Begriff der Schreibweise (‚écriture‘) stark, der zu folgenschweren Unterscheidungen und Analysen anstiften sollte. Dort spricht Barthes allerdings von nur drei Dimensionen des Schreibens, deren dritte, die ‚écriture‘, als Begriff und Geschichte damals noch zu entwerfen und beschreiben war. Etwa 50 Jahre nach erstmaliger Publikation des Texts kann man mit diesem Abstand und in Anbetracht erst jüngst stattgefundener Veränderungen, noch eine vierte Dimension charakterisieren (‚scripturire‘, nach Barthes), die im Akt des Schreibens Teil des Schreibens ist, und gemeinhin immer mitgenannt wurde, nun aber durch ihre fortschreitende Abwesenheit mehr und mehr ‚etwas‘ aus diesem komplexen Vorgang herausbrechen lässt. Dieses ‚etwas‘ zu erkunden, schien mir am vielversprechendsten auch über den Weg der materiellen Herstellung von Handschrift.
Materie, Material, Materialität (Zu den Rahmenbedingungen)
Kannst Du uns die Genese der Mehrstufigkeit deines Projektes erläutern? Welche Schwierigkeiten ergaben sich nach dem theoretischen Entschluss der materiellen Umsetzung?
Das Warum. Die Frage nach dem Antrieb von bewusst handschriftlicher Textproduktion als Experiment scheint mir einigermassen nachvollziehbar. Das Was dagegen stellte schon vor schwierigere Entscheidungen. Einerseits sollte eine Schrift entstehen, die ihr Wesen nicht (nur) abgelenkt von ihrer inhaltlichen Reflektion entfaltete. Zudem sollte sie auch Inhaltliches zur Handschrift mit einschliessen, also gleichzeitig auch ihr Thema benennen und untersuchen. Da die Anordnung der eines Selbstversuchs entsprechen sollte, wollte ich auch Elemente des Selbst („Ichschrift“) in Form von biographischen Äusserungen (Biographemen) verarbeiten, die auch gewissen narrativen Strategien, wie z.B. bestimmten ästhetischen Kategorien einer kleinen Form, folgten.
Schon waren zwei Schreibansätze und -anlässe entstanden. Der thematische Zugriff sollte also aufgrund der Beschäftigung mit Schriften und Sekundärliteraturen hierzu geschehen. Hier gingen Recherchen voraus. Jüngere bis ältere Literatur zum Thema aus unterschiedlichsten Wissensdisziplinen wurde zusammengetragen, begutachtet und auf Referenzstellen hin gelesen. Signifikante Exzerptstellen wurden festgelegt, die als Vorlage zu einer Abschrift hergenommen wurden. So konnte in einem Gang das Thema zumindest breit und an der Oberfläche angeeignet werden. Gleichzeitig wurde aus der Abschrift ein erster Teil einer Ichschrift-Einheit (eines Kapitels, einer Schrift-Probe, wenn man so will, als Initial/Initiant). Der als eher narrativ gedachte Teil, der sich mit Biographischem beschäftigen sollte und ein unterbrechungsärmeres Schreiben befördern sollte, versucht dabei, einen Impuls aus dem ersten Teil zu übernehmen.
Eine wie auch immer evozierte Quintessenz oder Assoziation aus der Abschrift, die auf einen intimen, privaten Bereich oder ein Ereignis verwies, sollte also einen jeweiligen Schreibprozess auslösen, in dem Erinnerungen, Rekonstruktionen oder Anverwandlungen miteinbezogen wurden. Daraus sind nicht immer Erzähl- oder Erinnerungstexte geworden. Bewusst wurde zugelassen, dass ein Biographem sich auch in anderen Textsorten oder -formen (Listen, Verdichtungen, Analysen, sprachlich heterogenen Passagen) äußern konnte.
Ein weiterer, dritter Teil eines Ichschriftexemplars, sollte sich explizit mit dem Schreiben in Verbindung mit reflektorischen oder sublimatorischen Prozessen beschäftigen. Dabei wurden die ersten beiden Teile (Die Abschrift, die Ichschrift) hergenommen und versucht, diese in irgendeiner Form zu kondensieren, zu abstrahieren oder sonstwie verdichtet ineinander zu legen. (Kurz habe ich mir überlegt, dies „die Umschrift“ zu nennen.) Aufgrund dieser drei Um- bzw. Vorzustände von Textproduktion wollte ich ein kleines Spektrum an Produktionsvorzeichen erzeugen, das überhaupt eine systematische Produktion sicherstellen konnte und gleichermassen damit gewisse inhaltliche Fäden, an die angeknüpft werden konnte, generieren bzw. auslegen.
Schon bei der Planung dieser Anordnung kam die Überlegung, da die Ergebnisse auch digital verwertbar sein sollten, die Schrifterzeugung und –abbildung mit aktuell gängigen Möglichkeiten in Angriff zu nehmen. Nach diversen Tests mit Scannern, Softwares und digitalen Notizblöcken wurde festgelegt, dass aufgrund von größeren, auch theoretisch offeneren Anwendungsmöglichkeiten ein digitaler Notizblock ein gutes Urmedium der Niederschrift sein würde.
Im Laufe dieser Überlegungen und nach weiteren Tests kam dann noch der Einfall, eine weitere Eigenschaft solch eines digitalen Notizblocks zu nutzen, derjenigen der Schrifterkennungsoption. Also wurde dem strukturierten Apparat einer Ichschrifteinheit auch noch eine vierte Dimension hinzugefügt, nämlich die der automatischen Lektüre und Schrifterkennung (OCR). Nach jeweiliger Verschriftung der drei Teile sollten diesen als digitaler “Druck“- oder Typotext eine automatische Schrift gegenübergestellt werden, die aber freilich auf einem anderen Schreibprozess fusste. Vor Nutzung des OCR-Programms musste ein Schriftabgleichprozess durchlaufen werden, ein Training, das die Software mit meiner Handschrift in einem gewissen Grund- oder Nullzustand vertraut machte und festlegte. Somit ist also in jedem Kapitel oder jeder Ichschrift-Gesamteinheit eine Struktur aus den Elementen Abschrift, Ichschrift, Umschrift und OCR angelegt.
Erst viel später, also nach Beendigung der Manuskriptherstellung, wurde entschieden, dass dieser Vierteiligkeit, auch aus Gründen eines Lektüreangebots auf konventioneller Basis, eine Art “gesetzter“ Text gut täte. Dieser sollte das Ergebnis und Produkt der jeweils stattgefundenen Prozesse in sich aufnehmen und als poetisches Amalgam im wörtlichsten Sinne und in Form einer Transkription für sich lesbar sein. Diese Transkripte wurden als Einheit und Anhang hinter dem Manuskriptteil gedacht.
Kleine Formen, Semiose
Welche Folgen hat das handschriftliche Verfassen von Texten etwa in formalästhetischer Hinsicht und nicht zuletzt in Hinsicht auf den Inhalt des Textes und sein Bedeutungspotenzial?
Um überhaupt an ein Schreiben zu denken, ausgehend von einer Idee, die sich noch auf der Suche nach ihrer Form befindet, einer kaum umrissenen Einheit also, die sich bislang lediglich in einer Wolke von Begriffen zusammenziehen könnte, näherte ich mich dieser Unternehmung über ein Denken in Modulen, oder besser: einem, wie bei vielen Schreibenden üblich, Erzeugungsprozess von kleinen Elementen, die in sich schon gewisse poetische Spuren oder Kerne, Ansätze oder Skizzen hinsichtlich eines Themas tragen, also möglicherweise einen Satz von Variablen darstellen, die aber offen genug sein müssen, als Gerüst und Baustelle eines grösseren Zusammenhangs zu dienen, gleichzeitig aber auch als unabhängige, frei stehende Skulptur figurieren könnten, soweit und insofern ausgeführt, dass ein klarer Gedanke oder eine Idee, zumindest extrahierbar, ableitbar oder zu erahnen wäre, dies wenigstens mit einigen, wenn auch kleinen Schnittmengen zu Elementen mit vielfach anderen “Variablen“.
In einer (Ichschrift-)Einheit als “kleiner Form“ können narrative, poetische, prosaische, assoziative, automatische, deskriptive und transkriptive Passagen ineinander übergehen oder sich miteinander in Beziehung setzen bzw.: sie werden miteinander konfrontiert. Erklärtes Ziel war es ausdrücklich nicht, solide, abgeschlossene Texte zu fabrizieren, die dann auf Kohärenz analysiert werden könnten, sondern ein Ergebnis anzustreben, eine Schrift, ein Schriftstück, das einen gesamten ästhetischen Prozess abbilden kann, aber unter einem anderen Modus der Bewusstseinsübung. Vielleicht mag man das ein stark strukturalistisch beeinflusstes Verfahren nennen, aber diese Produktion sollte, da nicht wiederhol- oder verfeinerbar, auf stabilen Parametern aufbauen, die ein spezifisches Gewebe oder Geflecht mit offenem Ausgang konzipiert und dieses auch sprachlich wieder einzufangen vermag.
Ob und inwiefern die Anerkennung dieses Verfahrens auch auf Rezeptionsseite stattfand oder bestimmte Effekte zeitigte, kann hier leider nicht beantwortet werden. Aber aus eigener Beobachtung heraus bin ich versucht zu sagen, dass, was die Beurteilung des eigenen Textes angeht, eine über die Handschrift produzierte kleine Form tatsächlich qua solcherlei Massnahmen der Ästhetisierung von heterogenen Texten viel mehr noch als konsistente “kleine Form“ im genannten Sinne gelesen wurde. Oder, zeichentheoretisch gesprochen: handschriftliches Schreiben arbeitet direkt oder hat Einfluss auf Inhalt und Gattung eines Textes. Die Verbindung von Signifikant (Handschrift) und Signifikat ist klar eine andere als letzteres mit typographischen Signifikanten.
Zirkularität
Welchen Einfluss hat die Materialität – im Sinne eines Sichtbarmachens – von Textentstehungsprozessen und -stufen für den Prozess des Textverständnisses (oder: der Textinterpretation)?
Durch die Einführung einer zweiten bzw. dritten Prozessstufe, der lécture automatique und der Interpretation maschineller Misslektüre der Ichschriften, wurde ein Mechanismus eingeführt, der in der Abfolge der (Schreib- und Verständnis-) Handlungen, der “Rekritüren“ (also: der Transkriptionen), in einer Handlungskette verläuft, die man so festhalten könnte:
Lesen – Erinnern – Verknüpfen – Schreiben – Lesen
Diese Zirkularität wird in mehrfacher Weise sinnfällig. Und sicher könnte sie nach obigem Modell immer weiterbetrieben werden. Nach gewissen (Zeit-)Abständen könnte beispielsweise das so entstandene Material theoretisch wieder aufgenommen werden und eine (rezeptive, skriptive, poetitive) An- und Neuverwandlung, ein weiterführender Schreibprozess, ausgelöst werden.
Mit genügend zeitlichem Abstand, nach Schicksalsfügungen beispielsweise – man denke an Paul Klees verwitternde Hand, die mit ihrer fortschreitenden Unbrauchbarkeit ganz andere Texte, Längen, Inhalte und damit: ganz andere Werke schuf – würde sich auch die Schriftästhetik eines Folgeprojektes verändern und wäre im Abgleich in der Tat mit jener nuancierten Zeichnung eines Verstehensprozesses vergleichbar. Die Ichschrift ist also nicht nur Gebrauchstext, sondern ein manchmal historischer, manchmal ein literarischer Korpus von Aufzeichnungen.
Das Gadamersche Modell einer Textannäherung bzw. -begegnung, eines Verständnisses von Text, das nur über das Vorhandensein von Vorverständnis gebildet werden kann, da sonst generell kein Verstehen möglich wäre, schliesst hier die Außergewöhnlichkeit ein, dass historischer Produzent und Rezipient des Textes in dieser Anordnung zusammenfallen. Das Objekt wird damit in seiner existentiellen Struktur um einen Subjektanteil erweitert, und damit verschiebt sich ein quasi-historisches Interesse durch mein eigenes Lesen meines Geschriebenen, das zwar grossenteils wieder präzise erinnert, aber auch mehrdeutig rekonstruiert (und hier wird der Vorverständnisanteil explizit) zu einer Analyse “meiner Selbst“, das so Subjekt zweiten Grades dieses Texts wird.
Das Selbst erster Ordnung als Interpretationsquelle in diesem hermeneutischen Verständnis ergibt sich aber nicht nur aus einer historischen, sondern hier auch speziellerweise: ästhetischen Differenz. Eine Ausweitung der Verstehenszone “meiner Selbst“ wird also durch eine zusätzliche “Irritation“ ästhetischer Differenz begünstigt.
Die Präzisierung eines Selbstverständnisses durch – nicht Schmälerung, sondern – Verbreiterung der Materialbasis von Sinnlichkeit (der gleichzeitigen Möglichkeit differenter Quellarten von Subjektivität), verschiebt dieses Textensemble noch stärker in den Objektstand. Und das so aufs Selbstverständnis angewendete Modell hermeneutischer Zirkularität, der Beschäftigung mit Text in der Denkfigur eines Zirkels, käme hier als gültige Metapher sowie Element einer beliebig formulierten Poetologie in Frage.
Allein: Der Begriff der “Quelle“ bei einer tatsächlichen historischen Differenz von eineinhalb bis zwei Jahren, der durchschnittliche Zeitabstand zwischen Handschriftenproduktion und Relektüre der Elemente, mag stark übertrieben sein. Doch können auch jenseits quellenkritischer Begrifflichkeit der Prozessmechanismus und die darin beinhalteten Verschiebungen als solche beschrieben werden, sieht man die „ästhetische Differenz“ als manifesten Aspekt einer hermeneutischen Differenz.
Auf welche These soll das abzielen? Mit dieser kleinen Überlegung soll begründet und nachvollzogen werden, dass ein nichthandschriftlich verfasster Text von Grunde aus als einer mit einer verengten Aspektierung von Textverständnis in der (Selbst-)Rezeption aufgefasst werden muss, kurz: Quelle ist nicht gleich Quelle. Und etwas radikaler: typographierter Text ist somit von vornherein reduzierter Text, seine Lektüre wird im Rahmen einer Reduktion des Verstehensprozesses angenommen und verstanden, vor allem, wenn das Zuverstehende man selbst ist. Eine apriorische und unmittelbare Erzeugung von z.B. digitaler Textlichkeit muss aber damit auch automatisch eine Enthistorisierung von Textualität bedeuten. Eine Untersuchung von Prozessen bleibt somit immer eine Untersuchung von Schwundstufen und hinter theoretischen Möglichkeiten zurück.
Ichschrift und Differenz
Welche Funktion hat für Dich das OCR-Verfahren, dem Du die Texte unterziehst? Gibt es Assoziationen zwischen dieser letzten Stufe oder vierten Dimension und der Handschriftlichkeit, die über eine “Misslektüre“ hinausgehen? Was bezweckst du mit der Provokation und Darstellung von Misslektüre?
Ein anderer, ein historisch fast schon gegenläufiger Ansatz drängt sich in diesem Spiel (mit) der Schrift, gewagten Titelungen und Rekapitulationen beinahe zwangsläufig auf und kann Schriftverlust weiter prononcieren und, je nach Perspektive oder Position, gut- oder schlechtheissen.
Der oben auch als “Misslektüre“ bezeichnete Einsatz maschineller Intelligibilität kann und soll hier einmal positiv formuliert und begründet werden.
Vielleicht ist man also besser mit Begriffen aus dem Spektrum der Para- oder Konlektüre bedient, da diese bei der Begutachtung der Zeichen, ihrer oftmaligen Stummheit oder auch Nichtlesbarkeit, ein Spiel mit Differenzen, sowohl beim Aufeinandertreffen von Text und Paratext als auch im Transkriptionspart auslösen, und das – nun auch – sinnliche Aufklaffen und Auseinanderfächern löchriger Bedeutungsstellen begünstigen und ausstellen.
Im Falle der Berücksichtigung von Schriftästhetik muss daher von einer dreifachen Differenz (räumlich, zeitlich und ästhetisch) ausgegangen werden, und davon, dass sich die Bedeutungsbeziehung von Zeichen und Sache im Zeichenfalle verdoppelt, weil sich zwischen Text (Schrift) und Objekt (Bedeutetes), so meine Erfahrung, automatisch das somit zwittrige Textobjekt “Typotext“ schiebt.
Anders formuliert: Das OCR-Verfahren bietet weiterhin die Möglichkeit intelligibel überführten Text wieder mit Spuren, Annotationen oder Konnotationen etc. anzureichern, die im Prozess temporierter Lektüre verloren gegangen sind.
Der so einerseits wieder rückgebundene (retemporisierte) Schrifttext, andererseits räumlich und qualitativ erweiterte Ursprungstext (jeder Ichschrifteinheit), ist also aus dekonstruktivistischer Sicht nichts weniger als ein Versuch, auch ästhetischen Sinnverlust zu begründen und zu kompensieren; auch jenseits eines angenommenen (Text-)Subjekts oder Ichs.
Auch aus logozentrismuskritischer Perspektive wäre also eine zunehmende Absenz von Handschriftlichkeit im Rahmen fortschreitender Medienumbrüche zu beklagen.
(Anm. d. Red.: Der zweite Teil dieses Interview-Essays wird in Kürze in der Berliner Gazette veröffentlicht.)













 MODELL AUTODIDAKT
MODELL AUTODIDAKT KOMPLIZEN
KOMPLIZEN
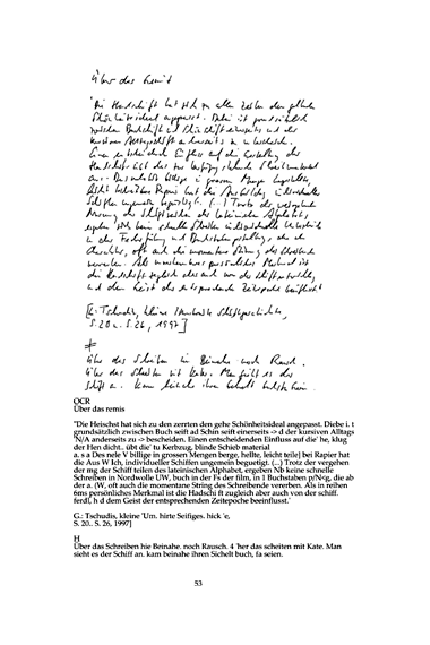
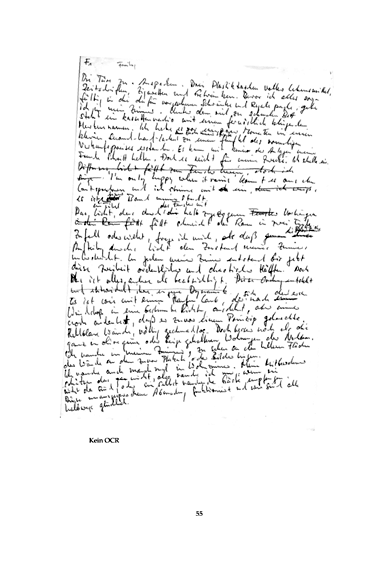



10 Kommentare zu
Handschrift in der Malerei ist nicht ganz "Nullpunkt"-textlich?
Handschrift oder Handschriftliches:
veraendert - nicht vergehend.
Robert Walsers "Geschwister Tanner"
( http://www.stroemfeld.de/de/buecher_G_4_1/ )
und musste bei der Lektüre des obigen Interviews auch an die Ausführungen von Joseph Vogl in "Über das Zaudern" denken, wenn er, im Hinblick auf das Zaudern, Handschriften Kafkas analysiert.
Im ersten Fall (Walser & Stroemfeld) geht es bei der Handschrift um größtmögliche Nähe zum eigentlichen literarischen Ausdruck des Schriftstellers (unverstellt und unverfremdet durch Editorenhände).
Im zweiten Fall geht es bei der Handschrift um größtmögliche Nähe zum Subjekt, genauer: zum Subjektivierungsprozess, den das Schreiben ermöglicht, mit sich bringt, etc.
Ich schreibe sehr viel mit der Hand, und ich schreibe sehr viel mit dem Computer. Mir scheint, dass ich beim Computer das lesende Publikum (und die Form eines Textes) mehr mit-denke (was nicht heißt, dass z.B. der Tagebuchschreiber das nicht täte und nur privat wäre - auch daran glaube ich nicht, obwohl mir männliche Tagebücher stärker auf das Publikum ausgerichtet scheinen und oft 'Arbeitsbücher' sind). Wertungen vermag ich nicht vorzunehmen - oder nur wenn ich Briefe bekomme - die habe ich noch lieber als e-mails :-)